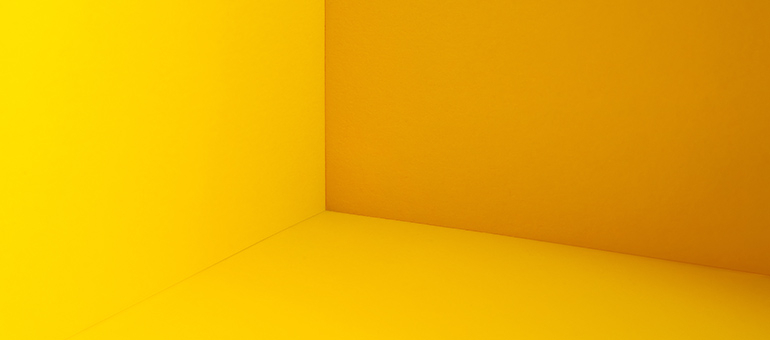Wohnen & Leben
Wien wächst seit einigen Jahren rasant. Die Stadt setzt verschiedene Maßnahmen um, um dem Bevölkerungszuwachs beizukommen. Vor allem durch Nachverdichtung soll neuer Wohnraum geschaffen werden. Doch dadurch geht zunehmend Stauraum verloren.
Im Zeitalter der Shareconomy werden kollaborative Kulturtechniken auch auf das Wohnen übertragen: In Zukunft werden wir immer mehr Wohnfunktionen auslagern. Ein Ergebnis des Zukunftsinstituts.
Hochhäuser findet er nur von Weitem betrachtet toll, Autos gehören für ihn aus der Innenstadt verbannt, und die Bevölkerung müsse in die Gestaltungsprozesse einbezogen werden: Matthias Oppliger sprach für die Schweizer Tageswoche mit dem dänischen Städteplaner Jan Gehl.
Im Rahmen ihres Kommunikationsdesign-Studiums an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin porträtierte Anna Gröschner verschiedene Selfstorage-Kunden und ihre Abteile und Habseligkeiten. Ihre Umsetzung des Themas "Identität" präsentiert sie hier.
Was ist wirklich wichtig im Leben? Petri Luukkainen wagte ein Experiment: er verstaute alles, was er besaß, in einem Selfstorage-Abteil. Ein Jahr lang durfte er jeden Tag einen Gegenstand herausholen, so begann das Experiment nackt in einem leeren Apartment.
In seinem Gastbeitrag "ZUKUNFT DER STADT - Berlin braucht eine lebendige Zivilgesellschaft" für die Berliner Zeitung beschreibt Prof. Wolfgang Kaschuba warum Berlin auf selbstbestimmte Bürger vertrauen muss, um der Gefahr des Ausverkaufs der Stadt zu begegnen.
Aus dem Forschungsprojekt "Nutzungsmanagement im öffentlichen Raum" der Hochschule Luzern hat sich eine Arbeitsgruppe des Schweizerischen Städteverbandes, das Zentrum öffentlicher Raum (ZORA), entwickelt.
Im Rahmen des Studienprojektes "Tempelhof. Das Feld" erarbeitete Prof. Wolfgang Kaschuba mit seinen Studierenden am Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität zu Berlin zur Nutzung des ehemaligen Flughafen-Geländes Tempelhof. Die Ergebnisse wurden nun in Form einer Broschüre publiziert.
Der spatial turn hat inzwischen auch die Kontexte von Künsten, Kultur, Bildung und Sozialem erreicht: Ästhetische Erfahrungen werden immer in der sinnlichen Auseinandersetzung mit der Umwelt gemacht, weshalb die natürliche oder künstlich geschaffene Umgebung großen Einfluss auf Lernen und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen hat. Vor diesem Hintergrund erhält der öffentliche Raum als existenzielle und personale Umwelt neue Bedeutung für ästhetische Erlebnisse und Aktivitäten. Diesen kulturpädagogisch zu erschließen und zu inszenieren wird zu einem neuen zentralen Ziel kulturell-ästhetischer Bildung.
Morgens halb acht in deutschen Zügen, U-Bahnen und Bussen. Die Menschen sind auf dem Weg zur Arbeit, Schule oder Uni. Die öffentlichen Verkehrsmittel füllen sich. Die wenigen Sitzplätze werden eingenommen, alle warten eng aneinander gedrängt bis zur richtigen Haltestelle. Derweil werden Zeitungen aufgeschlagen. Taschen verstaut wo es nur geht, Aktenkoffer eng an sich gezogen. Platzmangel wohin das Auge reicht.
In einem Podcast für Bayern2-radioWissen geht Autor Simon Demmelhuber einer Frage nach, die auch in diesem Blog immer wieder gestellt wird: Wie viele Dinge braucht der Mensch wirklich?
Das Zürcher Museum für Gestaltung zeigt die Ausstellung "Unterirdisch", die sich den unterirdischen Bauwerken der Städte widmet. Die NZZ veröffentlichte dazu einen interessanten Artikel.
Zwischen Deutschland und Südkorea liegen knapp 8.200 Kilometer, mit einem Direktflug braucht man durchschnittlich zehn Stunden um diese Strecke zu überbrücken. Beide Länder kann ich mittlerweile als mein Zuhause bezeichnen, auch wenn sie in mancher Hinsicht unterschiedlicher nicht sein könnten.
"Die Reste der IBA. Urban Living – neue Formen des städtischen Wohnens in Berlin", ein Artikel auf Bauwelt.de
Sammler, Künstler, Minimalisten - so gestalten andere ihren Wohnraum.
In der Stadt der Zukunft werden wir alle zu Akteuren, erklärt Stadtforscher Peter Mörtenböck in einem Interview mit dem Standard.
In seinem Beitrag zum Thema „Storage Places – Facilitatorinnen veränderter Lebensrealitäten“ vom 28. November 2012 wirft der Autor, Martin Schinagl, zum Schluss noch eine interessante Frage auf, auf die ich an dieser Stelle eingehen möchte – nämlich die Frage inwieweit sich die Nutzerinnenstruktur von Storage Places vor allem aus wohlhabenderen und unterschichtenverdrängenden Gentry zusammensetzt.
Mensch und Raum - Modelle, Bilder, Vorstellungen - ein Beitrag von Bayern2 RadioWissen
In seiner Bachelorarbeit an der FH Salzburg untersucht Sebastian Sohl Ursachen für den zunehmenden Platzmangel in Großstädten.
Rita Schilke arbeitet als "Aufräumcoach" in Berlin. Bei ihrer Arbeit begegnet sie immer wieder der Frage: Aufheben oder wegwerfen?
Behalten oder Wegwerfen? Pia Ratzesberger von der Süddeutschen Zeitung untersucht, ob weniger wirklich immer mehr ist und gibt Tipps zum Entrümpeln.
An den wenigsten Orten hat ein einzelnes Zimmer wohl so viele verschiedene Funktionen wie in einem Studentenwohnheim. Seit über vier Jahren lebe ich in einem Wohnheim und bin sehr froh, in zentrumsnaher Lage mein eigenes kleines und bezahlbares Reich zu haben. Mein Zuhause ist dabei gleichzeitig das Zuhause von 120 anderen Studentinnen und Studenten.
Präsentation der Diplomarbeit bei der Woche der soziologischen Nachwuchsforschung am Soziologieinstitut der Universität Wien
In dem Bemühen das Bewusstsein über unzureichende Wohnverhältnisse in Hong Kong zu schärfen sowie über Menschen zu berichten, die in extrem kleinen Wohnräume leben, entwickelte SoCo eine Fotokampagne, die Luftaufnahmen von unglaublich überfüllten Wohnungen zeigt.
Flexibel – ungebunden – dynamisch – anpassungsfähig – wandlungsfähig – agil – mobil. So lautet eine Reihe typischer Stereotypen die unseren heutigen Alltag bestimmen.